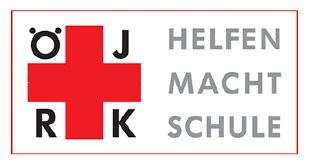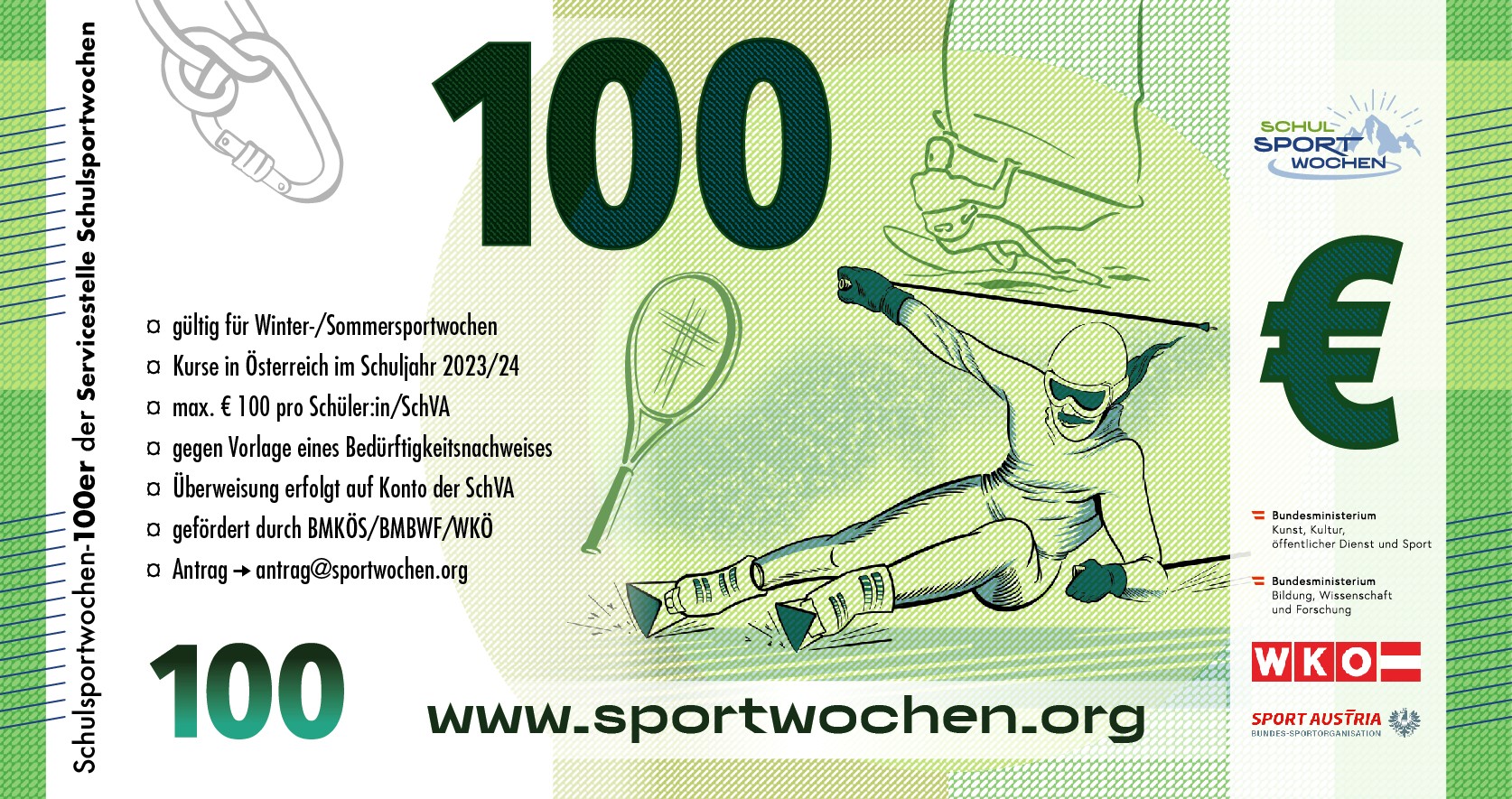LRS-Leistungsfeststellung und -beurteilung
LRS steht für Lese-/RechtschreibSchwierigkeiten und umfasst sowohl
o die Lese-/Rechtschreibschwäche als auch
o die Lese-/Rechtschreibstörung nach WHO-Definition ICD-10.
„Lese-/Rechtschreibschwierigkeiten sind ein pädagogisches Thema, das in die Schule gehört. Die Lehrpersonen sind als Fachleute befähigt, Lernschwächen von SchülerInnen zu erkennen, differenziert zu erfassen und qualifizierten Unterricht und Förderung anzubieten.
"Im Mittelpunkt des schulischen Umgangs mit Lese-/Rechtschreibproblemen steht die frühzeitige Identifikation dieser Probleme durch die/den KlassenlehrerIn mit dem Ziel, die Situation für die/den SchülerIn zu verbessern. Die Probleme sollen von den Lehrpersonen sicher erkannt, im gemeinsamen Austausch beschrieben/bewertet werden und dann in einer entsprechenden Unterstützung für die SchülerInnen ihren Niederschlag finden. Durch den Einsatz von standardisierten Screeningverfahren erhalten die Lehrpersonen zusätzliche Sicherheit in der Beurteilung einer allenfalls vorliegenden LRS.
Treten im Laufe des Lernprozesses bei SchülerInnen Schwierigkeiten auf, so sollten die primären schulischen Maßnahmen auf einen angemessenen Unterricht, eine entsprechende Leistungsbeurteilung und allenfalls eine Förderung abzielen. Dabei sind LRS-Kinder darauf angewiesen, dass auf Seiten der Lehrpersonen ein besonderes Problemverständnis vorherrscht. Die Entscheidung, welche individuellen Fördermaßnahmen für das jeweilige Kind Anwendung finden, liegt in der Verantwortung der Lehrperson. Grundsätzlich sind jedoch alle Möglichkeiten im Rahmen des Schulunterrichts auszuschöpfen, um die SchülerInnen beim Erlernen des Lesens und Rechtschreibens bestmöglich zu unterstützen. Dazu wäre es wünschenswert, wenn sich zumindest eine qualifizierte LRS-Ansprechperson an jeder Schule befindet.“ (aus: LRS-Handout - https://www.bildung-stmk.gv.at )
„Chancengerechtigkeit und Durchlässigkeit sind wichtige Zielsetzungen im österreichischen Schulsystem. Vorliegende Richtlinien geben die Möglichkeit, alle Schülerinnen und Schüler mit auffallenden Lese-/Rechtschreibschwierigkeiten zu unterstützen.“ Aus Rundschreiben RS 24/2021 (bmbwf)
Wie eine Umsetzung im schulischen Alltag erfolgt, ist sehr individuell. Nicht nur die Disposition des betroffenen Kindes sondern insbesondere auch die Positionen der Schulen bzw. Lehrpersonen sind sehr unterschiedlich. Das führt auch immer wieder zu Spannungen.
Im Rahmen von EuLe (Info für ElternundLehrpersonen) hat der Leiter der Abteilung Schulpsychologie und Ärztlicher Dienst Herr HR Dr. Josef Zollneritsch wichtige Einblicke und Anregungen vermittelt:
WICHTIG:
Je früher etwaige Schwierigkeiten erkannt und beachtet werden umso besser für das Kind.
Nicht die Note soll im Vordergrund stehen, sondern die Kompetenzen des Kindes, dh. was das Kind tatsächlich kann.
Die Kinder sollten die Grundstufe 1 (also die 2. Schulstufe) nicht ohne ausreichende Schreib- und Lesekompetenz verlassen.
ANNAHME:
Im Prinzip sind alle Kinder in der Lage, Lesen und Schreiben zu lernen. Die Frage ist jedoch, wie lange sie dafür brauchen/ wie leicht oder schwer sie sich tun.
Daher:
Ruhe im Lernprozess, denn sie ermöglicht die Entwicklung eines positiven Leistungs-Selbstwertgefühls des Kindes. Es braucht eine innere Gelassenheit, damit Entwicklungen in Gang kommen können. Den Kindern etwas zutrauen hilft, dass sich die Kinder selbst etwas zutrauen und ihr Selbstwertkonzept aufbauen.
Große, übersichtliche Schriftstücke (kein Zusammenkopieren von zwei A4 Übungsblättern auf ein A4 Blatt, ...), ausreichend Zeit (nicht Tempo statt Denken) jedoch Hilfestellung bei "Trödlern", ... , dienen der Unterstützung.
Zu bedenken:
Schulpflicht und somit Schuleintritt richtet sich nach dem Geburtsdatum (errechnet oder tatsächlich), sodass Unterschiede von bis zu 4 Entwicklungsjahren bei den Kindern einer Klasse vorliegen können. Damit einher geht oft ein Gefühl der Überforderung bzw. Überlastung.
Mitwirkung der Erziehungsberechtigten ist wesentlich. Sie sollen wissen, wie Schule funktioniert und was sie als Eltern, die in der Regel ja keine pädagogisch ausgebildeten Personen sind, beitragen können.
Vorlesen ist so ein wichtiger Beitrag zur Entwicklung von Sprachkompetenz und Freude am Lesen
Ein Vertrauensverhältnis zwischen Eltern und Lehrperson ist bedeutende Grundlage für eine erfolgreiche Zusammenarbeit: Niemand ist perfekt!
Wichtig: Man kann über alles reden und pflegt ein kooperatives Verhältnis.
- Zurück
- Weiter >>
- Details
- Kategorie: Elternbrief Mai 2025